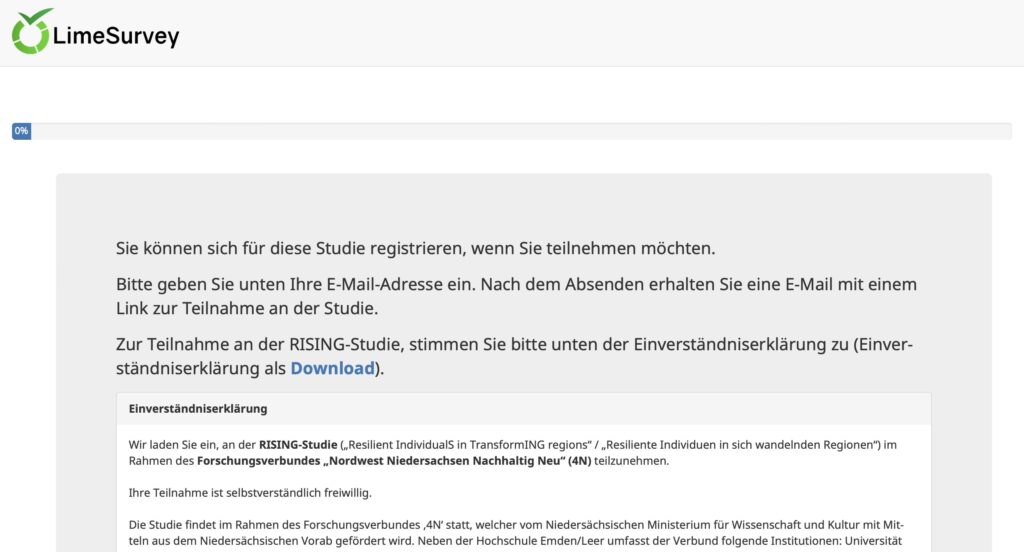Teilvorhaben 7: Landwirtschaftlicher Strukturwandel und Klimawandel-Anpassung

Im Teilvorhaben 7 werden Möglichkeiten untersucht, die zur Förderung der biologischen Vielfalt in der Agrarlandschaft beitragen, ohne dass dadurch die Produktivfunktionen stärker eingeschränkt werden. In einem der verfolgten Ansätze untersuchen wir, wie sich die Beschattung von Photovoltaik-Modulen auf die Entwicklung von Blühstreifen-Saatmischungen auswirkt. Ein Experimentalaufbau, der diese Beschattungswirkung und den Einfluss der damit verbundenen Veränderung von Temperatur und Feuchte untersucht, ist im Frühjahr auf einer Testfläche im Landkreis Cloppenburg aufgebaut worden. Ende Mai 2024 wurde die Entwicklung der Pflanzen den Mitwirkenden des Teilvorhabens in einer Besichtigung vor Ort vorgestellt und die weiteren Arbeitsschritte erläutert. Lichteinstrahlung, Niederschlagsmenge, Temperatur und Bodenwassergehalt werden durch Sensoren erfasst. Verschiedene Bereiche der Fläche werden geerntet (gemäht), um Biomasse und Artenzusammensetzung zu erfassen. Das ermöglicht einen Vergleich zwischen beschatteten und unbeschatteten Bereichen. Auch die unterschiedliche Feuchteverteilung könnte sich auf die Entwicklung der Pflanzenarten auswirken. Es wird erwartet, dass sich durch die verschiedenen kleinräumigen Bedingungen insgesamt die Vielfalt der Gesamtfläche erhöht. In welchem Umfang, das soll über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Eine weitere Experimentalanlage, in der ein Fokus auf der Photovoltaik-Nutzung liegt, wird zurzeit auf dem Gelände der Hochschule Emden errichtet.